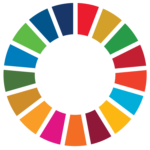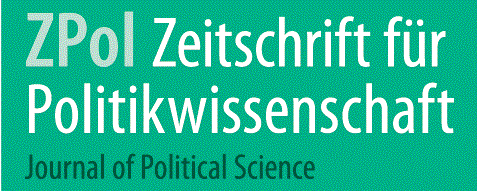Dr. Marcus Böick von der der Ruhr-Universität Bochum wirft einen Blick auf die Treuhandanstalt. Insbesondere die Wahlerfolge der AfD in den neuen Bundesländern haben das Interesse an der krisengeplagten „Nachwendezeit“ der frühen 1990er-Jahre verstärkt, in der der erhoffte wirtschaftliche Wandel für viele Menschen Ostdeutschland nicht wie erhofft eintrat. Welche Diskussionen um die Treuhand gab es, wie typisierte sich das Personal dort und was lässt sich aus der Geschichte der Treuhand für das Management abrupten wirtschaftlichen Wandels lernen?
Neben vielen anderen Dingen fand im Frühjahr 2020 auch eine gerade an Dynamik gewinnende Diskussion über die Rolle und Folgen der Treuhandanstalt ein abruptes Ende. Zahlreiche geplante Veranstaltungen und Konferenzen fielen der globalen Pandemie zum Opfer. Dabei wurde in den letzten Jahren so intensiv und kontrovers wie seit der Jahrtausendwende nicht über die Treuhand, den raschen Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft sowie die hiermit verbundenen, langfristigen ökonomischen, sozialen wie kulturellen Konsequenzen diskutiert.
Die umstrittene Treuhandanstalt
Wirtschaftsumbrüche im Ausnahmezustand gestalten?
Autor
Marcus Böick ist Akademischer Rat am Historischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutschen und europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2017 war eher Mitautor der Regierungsstudie zur „Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt“. 2018 erschien seine Dissertation „Die Treuhand: Idee – Praxis – Erfahrung“. Derzeit arbeitet er an einem Forschungsprojekt zur Geschichte privater Sicherheitsdienste im 20. Jahrhundert.
2020: Ein abgebrochener Gedenkmarathon
Neben vielen anderen Dingen fand im Frühjahr 2020 auch eine gerade an Dynamik gewinnende Diskussion über die Rolle und Folgen der Treuhandanstalt ein abruptes Ende. Zahlreiche geplante Veranstaltungen und Konferenzen fielen der globalen Pandemie zum Opfer. Dabei wurde in den letzten Jahren so intensiv und kontrovers wie seit der Jahrtausendwende nicht über die Treuhand, den raschen Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft sowie die hiermit verbundenen, langfristigen ökonomischen, sozialen wie kulturellen Konsequenzen diskutiert. Insbesondere die Wahlerfolge der AfD in den neuen Bundesländern haben das Interesse an der krisengeplagten „Nachwendezeit“ der frühen 1990er-Jahre verstärkt, wobei die kollektiven Traumatisierungen nach dem abrupten Ende der Zweistaatlichkeit oft im medialen Fokus standen und stehen: Für viele Menschen in Ostdeutschland stellten sich nicht, wie in der Euphorie des Jahre 1989/90 erhofft und versprochen, rasch „blühende Landschaften“ ein, sondern es bestimmten massive Umstellungskrisen einen Alltag, der von Abwicklung, Arbeitslosigkeit und Abwanderung geprägt wurde. Die Treuhand erscheint dabei, oft auch stark verkürzt, als Schlüssel zum Verständnis innerdeutscher Differenzen.
Kritiker vs. Verteidiger – eine endlose Diskussion?
Im Mittelpunkt dieser Diskussionen stand und steht dabei die Treuhandanstalt, die seit dem Sommer 1990 als federführende Agentur die dramatische Umgestaltung der über 4.000 Ost-Betriebe mit rund vier Millionen Beschäftigten übernehmen sollte. Dies erklärt natürlich, warum die Treuhand bereits zeitgenössisch zum hochumkämpften wie intensiv diskutierten Symbol und nach ihrer Auflösung Ende 1994 zum regelrechten Mythos avancierte: Galt sie den einen, vornehmlich konservativ-liberalen Politikern und Treuhand-Managern als weitgehend alternativlose Erfolgs- und Heldengeschichte, die auf den „Trümmern des Sozialismus“ wichtige „Aufräumarbeiten“ geleistet habe, verdammten andere Autoren vorwiegend linker und/oder ostdeutscher Provenienz die Treuhand als neoliberale oder gar verbrecherische „Verschwörung“ zur umfassenden „Enteignung“ der Ostdeutschen sowie zur „Abwicklung“ ihrer Industrie zugunsten der westdeutschen Großkonzerne. Dieses Spannungsfeld aus Kritikern und Verteidigern prägt die Diskussionen im Wesentlichen kaum verändert bis heute.
Wissenschaftliche (Wieder-)Annäherungen
Demgegenüber war es in der Forschung lange Zeit weitgehend still um die Treuhandanstalt geworden. Neben den bahnbrechenden politik- und verwaltungswissenschaftlichen Studien von Wolfgang Seibel und Roland Czada, die auf deren eigene empirische Forschungen aus den frühen 1990er-Jahren zurückgingen, hatte der Mainstream der Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften spätestens nach dem Jahr 2000 das Interesse an diesem sehr außergewöhnlichen, in vielerlei Hinsicht extremen Gebilde verloren, das kaum für übergreifende Prognosen oder Generalisierungen zu taugen schien. Die hiesige Zeitgeschichtsforschung entdeckte die Treuhandanstalt und ihre Aktivitäten erst vor kurzem, als sowohl entsprechend umfassende Fördergelder bereitgestellt als auch die außerordentlich umfangreichen Treuhand-Aktenbestände sukzessive geöffnet wurden. Die geschichtswissenschaftliche Debatte steht, aus empirischer Sicht, damit gerade erst am Anfang. Von daher galt es, dieses hochgradig mit sehr kontrastreichen Deutungen aufgeladene Thema entsprechend für die historische Forschung perspektivisch zugänglich zu machen.
Das Konzept: eine „Arena des Übergangs“?
In meinen eigenen, zeithistorisch ausgerichteten Arbeiten habe ich versucht, diese hochumstrittene Organisation durch ein bewusst abstrakt-distanzierendes Modell als gesellschaftlichen Begegnungs-, Konflikt- und Aushandlungsort zu konzipieren. Als zeitgenössisch hochgradig umstrittene Akteurin sowie zentrales Referenzobjekt der deutsch-deutschen „Umbruchs- und Übergangsgesellschaft“ in den frühen 1990er-Jahren wurde die Treuhand multiperspektivisch als „Arena“, als konkreter Begegnungs-, Interaktions- und Handlungsraum, historisiert. Auf diese Weise wurden die inneren und äußeren sowie kritischen bzw. affirmativen zeitgenössischen Deutungen („Erfolg“/„Scheitern“?) nicht fortgeschrieben, sondern umfassend kontextualisiert, um so einen neuen, kollektivbiographischen Beitrag zur (Praxis-)Geschichte zentraler zeithistoriographischer Debatten leisten zu können (Geschichte „nach dem Boom“, Nach-Geschichte der DDR, Geschichten von Neoliberalismus/Privatisierung bzw. Ko-Transformation/Postsozialismus, Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte).
Die Idee: ein „Sondermodell“ zur „Schocktherapie“
Die sehr rasche Etablierung einer unternehmerisch agierenden „Privatisierungsagentur“ war Endresultat einer im Herbst 1989 einsetzenden konzeptionellen Suchbewegung zur „Wirtschaftsreform“, die mithilfe zeitgenössischer Entwürfe ideengeschichtlich rekonstruiert wurde. In dieser wirtschaftspolitischen Diskussion wurden die gradualistischen Konzepte von DDR-Reformkommunisten bzw. Oppositionellen, bundesdeutscher Opposition sowie westlichen Ökonomen zugunsten eines radikalen Arrangements verworfen: Es wurde herausgearbeitet, wie die liberalkonservative Bonner Ministerialbürokratie im Frühjahr 1990 überraschend ein ideell an Ludwig Erhards Programmschriften aus den 1950er-Jahren orientiertes Modell eines rapiden Umbruchs von der Plan- zur Marktwirtschaft („Schocktherapie“) favorisierte. Dessen praktische Ausgestaltung sollte in die Hände von westlichen Managern und Unternehmern gelegt werden, die mit weiten Handlungs- und Gestaltungsräumen ausgestattet wurden.
Organisationspraxis: ein alltäglicher „Ausnahmezustand“
Diese neu geschaffene Treuhand wurde so, wie auch von Seibel und Czada intensiv herausgestellt, zu einer effektiven Wirtschaftsregierung im Osten, die gerade 1991/92 als regelrechter „Fremdkörper“ in einem permanenten Ausnahmezustand jenseits der föderalen Routinen agierte. Nach der abrupten Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion im Juli 1990 wurde die zunächst als „Verwaltungsstelle“ gegründete DDR-Behörde unter der Führung westdeutscher Industrie-Manager massiv aus- und umgebaut, um die über oft in extrem prekären Situationen befindlichen Unternehmen möglichst zügig an vornehmlich westdeutsche Investoren privatisieren oder stilllegen zu können. Auf Grundlage veröffentlichter Strategiedokumente sowie ausführlicher Medienberichte wurde die (in der Praxis oft chaotische) Genese der Organisation im Spannungsfeld von internen Dynamiken sowie externen Interventionsversuchen aus Öffentlichkeit, Politik und Umbruchsgesellschaft im Kontext der „Vereinigungskrise“ nachgezeichnet. Behandelt wurden die massiven politischen wie öffentlichen Kontroversen, die operative Geschäftspraxis, die strategischen Grundlinien sowie die Organisations- und Personalpolitiken: Wie wirkten die intensiven politischen und gesellschaftlichen Debatten sowie medienöffentliche Skandalisierungen auf das Innenleben der Organisation zurück? Wie passte der Treuhand-Vorstand in diesen bewegten Zeiten seine Ziele an – gerade mit Blick auf die von Rohwedder noch kurz vor seiner Ermordung ausgegebene Richtschnur, dass „Privatisierung die wirksamste Form der Sanierung“ sei? Schließlich: Wie ließ sich so rasch geeignetes Fach- und Expertenpersonal für eine kaum kalkulierbare Aufgabe gewinnen? Dem expansiven Auf- und Ausbau der Organisation unter Detlev Rohwedder bis zum Frühjahr 1991 folgte eine Phase forcierter Massenprivatisierungen unter Birgit Breuel bis Ende 1992. In den Folgejahren wurde die Treuhand zunehmend (struktur-)politisch eingehegt bzw. Ende 1994 stillgelegt. Das kurzfristig etablierte „Ausnahmeregime“ zur raschen „Überwindung“ von Planwirtschaft und Volkseigentum war damit beendet.
Erfahrungen: Experten-Personal an der „Frontier“
Basierend auf der eingehenden Analyse 1992/93 von Martin Kohli und Dietmar Rost erhobener, qualitativer Experten-Interviews wurde das Treuhand-Personal als sich intensiv selbst beobachtende und beschreibende Erfahrungsgemeinschaft typologisiert. Dabei wurden subjektive Herkunfts-, Motivations- und Erfahrungserzählungen herausgearbeitet, die den heterogenen Personalkorpus als soziales „Wimmelbild“ bzw. mentalitätshistorisches Panorama porträtierten: Ältere westdeutsche Manager und Unternehmer, bundesdeutsche Ministerialbeamte sowie ostdeutsche Planwirtschaftskader verhandelten in den Gesprächen über die Alltagspraxis des Wirtschaftsumbaus, Ost-West-Beziehungen sowie generationelle, geschlechterbezogene und transnationale Interaktionen. Trotz aller Differenzen begriffen sich die oberen bzw. mittleren Führungsmitarbeiter als Teil einer exzeptionellen, beschleunigten „Abenteurergemeinschaft“ an einer innerdeutschen „Frontier“ und werteten ihr individuelles Engagement als berufsbiographische Karriereklimax.
Praxis des Wirtschaftsumbaus in Umbruchszeiten
In der Zusammenschau der perspektivisch untersuchten Makro-, Meso- und Mikroebenen erscheint also die Treuhand als zeitgenössisch hochumstrittene „Arena“, als unternehmerisch orientiertes „Ausnahmeregime“, in der die postsozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsumbrüche in der ehemaligen DDR ideell konzipiert, praktisch gestaltet und individuell reflektiert wurden. Im spannungsreichen „Schnittfeld“ von Staat, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft sowie im „Schwebezustand“ zwischen DDR und Bundesrepublik sowie Plan- und Marktwirtschaft agierten die Mitarbeiter der Treuhandanstalt nach dem unerwarteten Ende des Realsozialismus als Treibende wie auch Getriebene einschneidender sozioökonomischer wie soziokultureller Auf-, Um- und Abbrüche. Sich selbst als patriotisch-pragmatisch agierende Alltagspraktiker des Wirtschaftsumbaus verstehend, erscheinen sie als „Revolutionäre des Kapitalismus“.
Ausblick: eine „Corona-Treuhand“?
Unter dem dramatischen Eindruck der gegenwärtigen Viren-Pandemie wurden erst jüngst Forderungen laut, rasch eine „Corona-Treuhand“ einzurichten, die zur kurzfristigen Bewahrung und anschließenden Privatisierung von Unternehmen dienen könnte, die durch den „Shutdown“ unvermittelt in eine akute Schief- und Notlage geraten sind. Der Staat könne durch eine „Treuhand 2.0“ ganz unmittelbar entsprechendes Krisenmanagement leisten. So extrem die Situation gerade ist, würde eine „Corona-Treuhand“ in gewisser Weise eine Wirtschaftskrise unter umgekehrten Vorzeichen bearbeiten müssen: Während die schockartige Wirtschafts- und Währungsunion für fast sämtliche Betriebe der über lange Jahre weitgehend abgeschotteten Zentralplanwirtschaft einen dramatischen Beschleunigungsschock einer globalisierenden Marktöffnung bedeuteten, haben zahlreiche gegenwärtige, meist durchaus wettbewerbsfähige Unternehmen demgegenüber mit einem radikalen Entschleunigungungsschock einer de-globalisierenden Marktschließung zu kämpfen, der durch die staatlicherseits allseits verfügten Abschottungen Liefer-, Transport-, Arbeits- und Konsumketten radikal unterbricht, die auch durch digitale Infrastrukturen nicht einfach ersetzt werden können. Das historische Beispiel der zwischen 1990 und 1994 agierenden Treuhandanstalt zeigt jedoch, dass sich bestimmte dramatische gesellschaftliche wie kulturelle Folgewirkungen eines extremen Umbruchsszenarios keinesfalls durch eine einzige Organisation „managen“ lassen, die so bestenfalls dem politischen System kurzfristig als eine Art „Schutzschild“ (Wolfgang Seibel) dienen könnte.
Zitationshinweis:
Böick, Marcus (2020): Die umstrittene Treuhandanstalt, Wirtschaftsumbrüche im Ausnahmezustand gestalten?, Essay, Erschienen auf: regierungsforschung.de. Online Verfügbar: https://regierungsforschung.de/die-umstrittene-treuhandanstalt/
This work by Marcus Böick is licensed under a CC BY-NC-SA license.